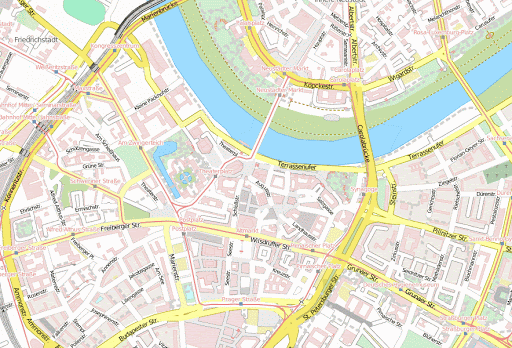Matthias Kirbs in der FAZ Sonntagsaugabe zum Thema Dialektreduktion

FAZ Autor Uwe Marx sprach mit mir und anderen Fachleuten über das Thema Dialekt-Reduktion. Und mit Menschen, die im beruflichen Kontext hier etwas für sich tun. Der Artikel „Ein Hoch auf das Hochdeutsch!” erschien in der jüngsten Sonntagsausgabe. Im einführenden Text heißt es: „Wer in Beruf Dialekt spricht, gilt als niedlich, mal als bemitleidenswert. Zuweilen bildet Dialekt sogar Vertrauen. Doch oft richtet er für die Karriere Schäden an” Wir lesen weiter:
„Die erfahrene Lehrerin war unglücklich. Eine Sächsin, unüberhörbar wegen ihres Dialekts, aber angestellt an einer Schule in Stade, Norddeutschland. Es war keine gute Konstellation. Sie habe sich von Schülern wegen ihrer sprachlichen Auffälligkeit gemobbt gefühlt, erzählt Matthias Kirbs. Also sollte er ihr das Sächsisch austreiben. Zumindest für bestimmte Situationen.
Kirbs ist Sprachtrainer, und als der Unterricht mit dieser Kundin vorbei war, habe sie ihm ein Video geschickt, sagt er. Darauf habe sie eine Abschlussrede gehalten, nicht auf Sächsisch, sondern auf Hochdeutsch. Einige Schüler hätten Schilder mit aufmunternden Sätzen darauf hochgehalten. Es sei ihr Dank dafür gewesen, dass ihre Lehrerin noch mal zur Schülerin geworden war. Eine Sprachenschülerin im Fach Hochdeutsch. Diese Geschichte aus Stade ist nicht nur eine Episode aus dem weiten Feld Beruf und Sprache, sondern auch die lange Antwort auf eine kurze Frage: Kann Dialekt Karrieren kaputtmachen?
„Die Sprache ist so etwas wie eine hörbare Visitenkarte“
„Durchaus, und zwar auf vielen Ebenen“, sagt Kirbs, der in Hamburg Stimmtraining und Sprechcoaching anbietet und Erfahrung als Schauspieler, Nachrichtensprecher und Kommunikationspsychologe hat. „Die Sprache ist so etwas wie eine hörbare Visitenkarte“, sagt er. „Deshalb kann ein Dialekt zum Problem werden.“ Manche Dialekte werden dabei als problematischer empfunden als andere. Nicht nur Kirbs, auch weitere Trainer, die sich um Stimme, Rhetorik und sprachliche Färbung kümmern, halten bestimmte ostdeutsche Dialekte für besonders heikel. Ariane Willikonsky zum Beispiel, die am anderen Ende des Landes, in Stuttgart und in Bolsterlang im Oberallgäu, als Sprecherzieherin und Kommunikationstrainerin arbeitet. Sie fragt rhetorisch, ob zum Beispiel Sächsisch besonders weltoffen rüberkomme. Und sie ergänzt, dass dieser Dialekt bisweilen dazu führe, von Gesprächspartnern „in die rechte Ecke“ gedrängt zu werden, nach dem Motto: Was nach Ostdeutschland klingt, könnte politisch heikel sein.
Das deckt sich mit den Erfahrungen von Matthias Kirbs. Er erzählt von einem Kunden, einem Physik-Professor, der sich in Hamburg manchmal regelrecht unter Nazi-Verdacht gesehen habe – nur weil ihm anzuhören war, dass er aus Thüringen kommt. Auch er war ein Fall fürs Sprachtraining.
Ein östliches Bundesland weiter auf der Landkarte, in Sachsen-Anhalt, sieht es schon anders aus. Hier gibt es zum Beispiel viele Call-Center für allerlei Branchen, weil der Dialekt als unauffälliger gilt. Nach breitem Sächsisch klingt er jedenfalls nicht; da fallen Gespräche mit Kunden in Schwaben, Schleswig-Holstein oder wo auch immer leichter. Keiner der Telefonberater muss die Sorge haben, missverstanden oder gar nicht verstanden zu werden. Denn Dialekt kann zwar einladen, aber auch ausschließen.
Ein bayerisches „Grüß Gott!“ etwa ist zur Kontaktaufnahme zwar nett, aber im weiteren Gespräch – vor allem in solchen mit beruflichem Hintergrund – geht es darum, auch im Detail richtig verstanden zu werden. Das Bayerische habe gegenüber dem Schwäbischen zum Beispiel einen Nachteil, sagt Ariane Willikonsky: Es erinnere an Lederhose, Bierzelt, Berge, also nicht gerade an ökonomische Kompetenz, während Schwäbisch – jedenfalls in dezenter Färbung – für wirtschaftliche Tugenden stehe. Das könne im Berufsleben in Gesprächen unter Geschäftspartnern durchaus gut ankommen.
Wer vor allem in seiner Region Geschäfte macht, kann mit einem Dialekt meistens gut leben, und sei er noch so breit. Wer aber nationale oder sogar internationale Kunden und Gesprächspartner hat, der sollte schnell wechseln können: vom Dialekt ins Hochdeutsche und wieder zurück, sobald es beruflich passt, also zum Beispiel die Konferenz oder das Verkaufsgespräch beendet ist. Im Sprachtraining geht es deshalb auch nicht um die dauerhafte, sondern um die vorübergehende Abgewöhnung des Dialekts. Das Hin und Her ist das Ziel.
Auffällige Karriere und auffällige Sprache sind selten
Das gilt auch für Führungskräfte. „In einem Team aus München oder Hamburg kann ein Vorgesetzter mit breitem Sächsisch Schwierigkeiten bekommen“, sagt Matthias Kirbs. Es geht um die Wahrnehmung und drohende Missverständnisse. Und manchmal auch um messbare Nachteile. „Im Verkauf zum Beispiel können durch Dialekt die Zahlen nachweisbar schlechter werden“, sagt er. In Verhandlungen oder Vertragsgesprächen seien die ersten Sätze oft entscheidend für Erfolg oder Misserfolg. Wenn aber der Gesprächspartner erst einmal grübeln müsse, welchen Dialekt er da gerade höre und wo sein Gegenüber wohl herkomme, könne ein Geschäft schnell platzen. Dann überlagere in den womöglich entscheidenden Momenten das Phonetische das Inhaltliche. Mitunter verhindere ein Dialekt sogar ein höheres Gehalt – wenn etwa ein Unternehmensberater für die hochpreisige Kundschaft nicht in Frage komme, weil ein zu breiter Dialekt dem entgegenstehe. Allerdings ist beides zusammen – auffällige Karriere und auffällige Sprache – selten. Ariane Willikonsky sagt, dass hierzulande in den Top-Positionen praktisch kein breiter Dialektsprecher zu finden sei. Sondern allenfalls Leute mit dialektaler Färbung.
In der großen Politik gibt es immerhin Protagonisten, die mit ihrem Dialekt nicht hinterm Berg halten und den Eindruck erwecken, dass eine regionale Sprachfärbung auch auf höchstem Niveau nicht schade: zum Beispiel die Schwaben Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und Günther Oettinger, Kretschmanns Vorvorgänger und inzwischen EU-Kommissar. Beide bringen eine Grundvoraussetzung für das Festhalten am Dialekt auch im anspruchsvollen beruflichen Kontext mit – großes Selbstvertrauen.
Außerdem könnte Kretschmann als Vorbild all jener Sprachschüler durchgehen, die ihrem Dialekt in Kursen und Seminaren zu Leibe rücken. Er kann nämlich nicht nur Schwäbisch, sondern auch Hochdeutsch, also hin und her wechseln, wann immer er will. Kretschmann ist in einem hochdeutschen Elternhaus aufgewachsen, das macht es leichter. Kürzlich erzählte er der F.A.Z., dass sein Sohn Vorbehalte dem Schwäbischen gegenüber am eigenen Leib zu spüren bekommen habe. Vielmehr: auf dem eigenen Zeugnis. Dort habe der – aus Norddeutschland zugewanderte – Lehrer moniert, dass Kretschmann junior im Unterricht Dialekt rede.
„Wer will schon immer beschmunzelt werden?“
Vermittelt Dialekt bei einem Politiker Bodenständigkeit und Volksnähe, so ist anderswo Verunsicherung vorherrschend. Matthias Kirbs formuliert das Handicap so: „Wer will schon immer beschmunzelt werden?“ Auch Vorstände oder Leute aus dem mittleren Management arbeiteten an sich, damit sie jederzeit von ihrem Dialekt ins Hochdeutsche wechseln können. „Und zwar vor allem, um ernster genommen zu werden.“
Bei ihm melden sich entweder Interessenten selbst oder Vorgesetzte, die Mitarbeiter schicken wollen, um deren Dialekt bei Bedarf förmlich abschalten zu können. Es sei das eigene Leiden, das Kunden zu ihm führe, oder die Ungeduld, ja das Genervtsein anderer. Das gilt auch für Deutsche im Ausland, denn Dialekt kann in Fremdsprachen nicht weniger heikel sein. „Wenn Sachsen oder andere Deutsche mit starkem Dialekt raus in die Welt gehen, kann auch das ein Problem werden“, sagt Kirbs. „Denn Ausländer erwarten diese Sprache nicht.“ Und sie reagieren womöglich nachteilig darauf. Umgekehrt gilt das so ähnlich. Handwerker in Deutschland zum Beispiel, die aufgrund ihrer Sprache als Osteuropäer zu erkennen sind, hätten in Preisverhandlungen einen Nachteil. Außerdem drohen atmosphärische Störungen. Russisch etwa klinge sehr hart, Deutsch mit russischer Färbung komme deshalb oft anders rüber, als es gemeint sei, härter, direkter. Damit könne nicht jeder Kollege umgehen und so mancher Chef schon gar nicht.
Der IT-Unternehmer Mathias Heinzler hat keinen Beschäftigten zum Sprachtraining geschickt – sondern sich selbst. Der Schwabe hat sein Hochdeutsch auf Vordermann gebracht, weil er andere Dialektsprecher beobachtet hat. Er sei beruflich in ganz Deutschland unterwegs, sagt Heinzler. „Oft habe ich bei größeren Gesprächsrunden wahrgenommen, dass Teilnehmer mit Dialekt es schwerer hatten, ihre Anliegen vorzutragen, um sich vor versammelter Runde Gehör zu verschaffen. Und ich hatte den Eindruck, dass sie auch viel mehr Überzeugungsarbeit bei der Umsetzung ihrer Ideen brauchten.“ Damals habe er sich vorgenommen, an seinem Dialekt zu arbeiten. Und zwar, „um in gehobeneren Gesprächsrunden meine Expertise und Fachkompetenz dialektfrei vortragen zu können“. Außerdem sei es ihm wichtig gewesen, in Stresssituationen und schwierigen Verhandlungen „kompetent und standhaft“ rüberzukommen und „nicht in meine ursprüngliche Dialektsprache zu fallen“. Er habe zwar immer schon „ein gewisses Hochdeutsch“ sprechen können. Aber als Schwabe sei er trotzdem immer erkennbar gewesen.
Heinzler sagt, er habe alles in allem acht Monate lang fast täglich an seiner Sprache gearbeitet, „an meiner Aussprache, vor allem aber auch an meiner Grammatik“. Mit diesem Pensum ist er ein durchschnittlicher Kunde. Harte Fälle brauchen hingegen länger als ein Jahr, um ihren Dialekt in den Griff zu bekommen. Im Training geht es um das Ändern sprachlicher Gewohnheiten, deshalb benötigen Schüler zweierlei: Zeit und ein Gegenüber. Präsenz in einer Sprachschule ist also wichtig und das Online-Üben zwar möglich – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll. Zum Beispiel, wenn Skype dabei eingesetzt wird. Was die Erfolgsaussichten sowie die Stärken und Schwächen seiner Klientel betrifft, sagt Matthias Kirbs: „Frauen sind etwas fleißiger. Sie sind auch aktiver, wenn es darum geht, Hochdeutsch im Alltag anzuwenden.“ Und genau diese Gewöhnung sei wichtig, um einem Dialekt den Garaus zu machen“